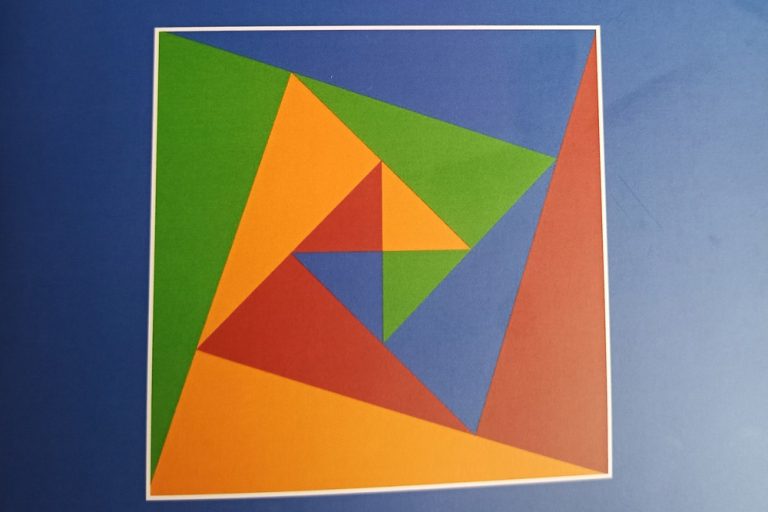Interview mit dem Hamburger Netzwerk Grundeinkommen, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Otto Lüdemann und Rainer Ammermann in den Kulturpolitischen Mitteilungen (Ausgabe Nr. 178, III/2022)
KuMi: »In Europa haben wir die gerechtesten Gesellschaften der Welt, die höchsten Standards bei den Arbeitsbedingungen und den breitesten Sozialschutz« – so beschreibt die Europäische Kommission die soziale Lage in der EU im Vergleich mit anderen Weltregionen.
Es gibt seit dem Göteborger Gipfel 2017 die europäische Säule sozialer Rechte, in einer Strategischen Agenda für 2019 – 2024 wird eine »Richtschnur für ein starkes soziales Europa des 21. Jahrhunderts, das gerecht und inklusiv ist und Chancen für alle bietet« für die Mitgliedstaaten ausgebreitet. Gleichzeitig sind die Kompetenzen der EU in der Sozialpolitik beschränkt; sie kann die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Arbeitsbedingungen nur unterstützen und ergänzen. So hat die Europäische
Kommission im Oktober 2020 dem Rat und dem Europäischen Parlament einen Vorschlag für eine Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in der EU vorgelegt.
Vor dem Hintergrund dieser Lage der »Sozialen Säule« der EU – wo sehen Sie die aktuellen Herausforderungen?
Im Weltmaßstab betrachtet mag die EU als vergleichsweise sozial gerecht erscheinen. Das macht jedoch nicht die massiven Defizite bei ihren sozialpolitischen Kompetenzen wett, führen die doch zu einem erheblichen Gefälle des Lebensstandards innerhalb der EU. Entscheidend ist, dass der europäischen
Exekutive die gesetzlichen Grundlagen und die Mittel fehlen, eine echte Sozialpolitik überhaupt zu konzipieren und konsequent durchzusetzen. Inhaltlich müsste eine alternative EU-Sozialpolitik
eine Doppelstrategie verfolgen:
- Auf der ökonomischen Ebene müsste sie möglichst nachhaltig den durch aktuelle Krisen aufgewor-
fenen Herausforderungen gerecht werden. Ansätze, die wie das vom Wirtschafts- und Sozialausschuss des EU-Parlaments ausdrücklich begrüßte Konzept der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) oder anderer vergleichbarer Bewegungen (etwa Donut- und Postwachstumsökono-
mie, MMT) können dafür eine Leit-Orientierung bieten.
- Auf der sozialpolitischen Ebene müsste sie statt bloßer Vermeidung extremer Armut vor allem allen EU-Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, um daraus ein »gutes« Leben werden zu lassen. Das Konzept des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) gemäß den dafür weltweit anerkannten Kriterien (d.h. anders als manche Konzernlenker
es gerne sähen) bietet dafür eine Orientierung.
KuMi: Ihr Bündnis hat ja eine Europäische Bürgerinitiative »Bedingungsloses Grundeinkommen in der gesamten EU« unterstützt. Wie könnte dies Ihrer Meinung nach in den europäischen Staaten soziale Ungleichheiten verringern? Und: Weshalb wurde ihrer Meinung nach das Quorum verfehlt?
Bei der erwähnten Initiative ging es nicht um das Ziel »soziale Gleichstellung«, was u.E. weder ein realistisches noch ein wünschenswertes Ziel wäre. Eher schon um Chancengleichheit bzw. überhaupt erstmal um die Chance, verfassungsmäßig garantierte, demokratische Grundrechte in Anspruch zu
nehmen und auszuüben. Etwa in Fällen extremer Armut ist dies nämlich z.Zt. keineswegs gewährleistet.
Allerdings beschränken sich unsere Erwartungen an ein BGE nicht auf dieses fundamentale Recht und Ziel. Vielmehr gehen wir davon aus, dass ein BGE für viele Menschen produktive Impulse zur »Selbstermächtigung« und »Selbstbestimmung« ihres eigenen individuellen Lebens, aber auch für vorher nicht mögliche Initiativen in Gruppen und Institutionen sowie in der Gesellschaft insgesamt auslösen würde. Ein europaweites BGE wäre in diesem umfassenden Sinn ein entscheidender »Kulturimpuls«.
Die Frage nach den Gründen für das Verfehlen des Quorums von 1 Million Unterstützungsbekundungen lässt sich schwerlich eindeutig beantworten. Einerseits haben die Pandemie und weitere hinzugekommene Krisen den Menschen die Dringlichkeit einer dauerhaften sozialen Absicherung massiv vor Augen geführt. Der Staat hätte also immense Bürokratiekosten eingespart, hätte es zu Beginn der Pandemie bereits ein BGE gegeben. Eine breite Unterstüt zung der EBI hätte somit nahegelegen.
Andrerseits bleiben Vermutungen, weshalb die Menschen sich in diesen Pandemiezeiten trotzdem damit schwertaten, zwangsläufig vage und spekulativ.
Wurde die Initiative medial nicht optimal vermittelt? War die Bevölkerung mit so viel Krisen schlicht überfordert? Gab es noch andere Gründe? Wir werden es vermutlich nicht erfahren.
KuMi: Trotz des Scheiterns der Europäischen Bürgerinitiative gibt es ja weiter ein großes Interesse an dem Thema. So hat das Bedingungslose Grundeinkommen Eingang in die Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas gefunden: »The most recurring sub-theme, with several ideas being highly endorsed and
commented on, concerns the unconditional basic income to ensure the ability of each person to participate in society«. Wie wird es hier Ihrer Erwartung nach weitergehen?
Die »Konferenz zur Zukunft Europas« ist mit den vorliegenden Empfehlungen noch nicht zu einem definitiven Abschluss gekommen. Die Empfehlungen werden vielmehr auf unterschiedlichen
Ebenen und in unterschiedlichen Gremien weiter zu behandeln sein.
Auch ein Verfassungskonvent mit der Möglichkeit, Vertragsänderungen zu erreichen, ist möglich. Wir werden diese Entwicklung aufmerksam verfolgen und uns im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter einbringen. Das von uns vorbereitete Ausstellungsprojekt zum Thema Grundeinkommen, zusammen
mit den in seinem Rahmen möglichen Veranstaltungen, sehen wir als Chance, das Thema wie die damit verknüpften Herausforderungen im öffentlichen Bewusstsein präsent zu halten.
KuMi: Im Februar haben Sie sich um eine Förderung im EU-Programm CERV beworben. Gibt es schon eine Rückmeldung zu Ihrem Antrag? Welche Ideen sollen mit Ihrem Projekt verwirklicht werden?
Die erfolgte Rückmeldung zu unserem Antrag besagt, dass wir zwar nicht sofort eine Zusage erhalten haben, dass unser Projekt aber auf einer Reserveliste die Chance erhalten wird, im Rahmen eventuell verfügbarer finanzieller Ressourcen gegen Ende des Jahres doch noch berücksichtigt zu werden.
Wie schon angedeutet, möchten wir mit der Ausstellung »Mensch, Grundeinkommen!« eine offene Informations- und Diskussionsplattform schaffen, welche die Idee des BGE zu den Menschen bringt. Sie selbst sollen sich ein Bild machen und entscheiden, ob sie sich in dieser Idee wiederfinden.
Wir danken für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Butt-Pośnik, Kontaktstelle CERV.
Das Dokument gibt es >> hier zum Download.